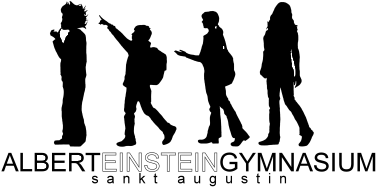|

Im Geographieunterrichts beschäftigen wir uns mit folgenden grundlegenden Herausforderungen:
- der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen für Folgegenerationen durch nachhaltiges Wirtschaften sowie durch soziales und ökologisch verträgliches Handeln,
- der Erfassung von Chancen und Risiken, die mit der zunehmenden Globalisierung, aber auch der Regionalisierung verbunden sind,
- der Abbau von Disparitäten auf verschiedenen Maßstabsebenen durch verantwortungsbewusstes Handeln zur Schaffung zukunftsfähiger Lebensverhältnisse sowie
- der Gewährleistung eines friedlichen Miteinanders durch interkulturelles Verständnis.
Grundvoraussetzung jeglichen raumbezogenen Denkens und Handelns ist die Fähigkeit zur Orientierung auf verschiedenen Maßstabsebenen und mithilfe von thematisch unterschiedlichen Orientierungsrastern.
Am AEG wird Erdkunde in der Sekundarstufe I in den Jahrgangsstufen 5, 7, 8 und 10 unterrichtet, in der Sekundarstufe II wird das Fach Geographie in Grund- und in Leistungskursen (wählbar in der Q1) unterrichtet.
|
|


|